Zum Artikel
Saalhauser Bote Nr. 28, 1/2011
Zurück
Inhalt
Vor
Erinnerungen, Erlebnisse und Abenteuer eines Saalhausers
Vorwort von Alexander Rameil-Flurschütz:
Der Gregors Zweite: Franz-Josef Heimes, geb. am 23. Juni 1939

Großeltern väterlicherseits mit Papa, Onkel Franz und Tante Maria. Die Großmutter soll sehr fromm gewesen sein. Sie beichtete jeden Samstag – nach jeweils 2 stündiger intensiver Gewissenserforschung.

Großeltern mütterlicherseits, Elisabeth und Anton Hegener, Selkentrop. Sie hatten 11 Kinder. Hegeners hatten einen ziemlich großen Bauernhof.
Prof. Dr. Franz-Josef Heimes ist Wissenschaftler, Weltenbummler, Pionier in der Luftbildvermessung, Hobbypilot und zugleich ein heimatverbundener Sohn unseres Ortes.
In einer mehrteiligen Biografie berichtet er an dieser Stelle aus einem ereignisreichen Leben – von der Kindheit in den Saalhauser Kriegs- und Nachkriegsjahren, seine erste Weltreise, spektakuläre Polarexpeditionen bis hin zu seinem Wirken als Hochschullehrer an der Uni Bochum.
1. Einige frühe Erinnerungen
Ich wurde 69 Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geboren. Ich soll mit 10 Pfund Lebendgewicht als „schwerer Brocken” zur Welt gekommen sein, s. auch Abb. 3. - Als Schwester Marlies 1942 folgte, soll ich geweint haben. Bruder Antonius war der „Erstgeborene” (1936); Alfons wurde als „Nachkriegs-kind” (1946) geboren. - Ich war sehr schüchtern; das hatte für meine Eltern den Vorteil, dass ich als „artiges und pflegeleichtes Kind” galt.
Meine frühen Freunde waren Schmelters Hubert und Schlehdorns Franz-Josef. Schlehdorns bewohnten damals mit ihren 6 Kindern unsere Scheune – heute wohnen Schlehdorns in Lenne (das erste Haus rechts, wenn man von der B236 abbiegt nach Harbecke). An beide Freunde habe ich zumindest je eine unangenehme Erinnerung. Hubert „schubste” mich in die offene Jauchegrube, die so tief war, dass ich echt „baden ging”. Und Franz-Josef passte nicht auf, als wir einen schweren, mit Brennholz gefüllten Metallbehälter über die Freitreppe in Schlehdorns Wohnung zu „wuchten” versuchten. Ich befand mich unterhalb des Behälters, als er losließ. Der Metallbehälter „knallte” gegen meinen Kopf; eine deutlich fühlbare Narbe ist bis heute geblieben.

Weihnachten 1939, Papa und Mama mit Antonius und Franz-Josef.
In den Kriegs- und Nachkriegsjahren mussten wir zwar keinen direkten Hunger leiden. Aber bestimmte Artikel waren unbekannt. „Warum, warum ist die Banane krumm?”
Bei Hessmanns (wohnten in einem Doppelhaus zusammen mit Flurschütz) gab es eine „Dekorationsbanane” aus Porzellan. An diese kann ich mich seltsamerweise erinnern – sie war krumm und gelb!! Auch Apfelsinen oder Süßigkeiten waren bis Ende der 40er Jahre unbekannte Luxusgüter.
Weihnachten war immer das größte Fest des Jahres. Mit großer Spannung wurde den Geschenken entgegen gefiebert. An mein „Trampelauto” kann ich mich noch bestens erinnern. Es war aus Metall und wunderbar lackiert. Ich liebte es heiß und innig. Erst viel später habe ich erfahren, dass Trösters Josef es in mühevoller Kleinarbeit zusammen geschraubt und geschweißt hatte.
Mama stammte aus Selkentrop (geborene Hegener). Es waren 2 Stunden zu Fuß von Saalhausen durch den Böddes am Greitemann-Stein vorbei bis Selkentrop. Alle paar Wochen mussten wir diese Strapaze auf uns nehmen. Zurück ging es manchmal denselben Weg. Wenn wir Glück hatten, wurden wir auch mal von Onkel Josef mit der Kutsche zum Bahnhof nach Schmallenberg gebracht. –

Abb.4: Antonius und Franz-Josef. Die langen Strümpfe wurden von Strumpf-bändern, die am „Leibchen” befestigt waren, in Position gehalten.
An eine „Rückwanderung”, allein mit Papa, über Felbecke, Werpe zum Bahnhof Schmallenberg kann ich mich noch gut erinnern. Es muss im Herbst 1944 gewesen sein. Das Kriegsgeschehen war schon bedrohlich nahe gekommen.
Wir wanderten in der Dunkelheit. Immer wieder wurde die Nacht aufgehellt durch mysteriöse Lichtstrahlen. Papa erklärte mir, dass diese von Flak-Scheinwerfern ausgelöst würden. Im Ruhrgebiet waren Flakscheinwerfer-Divisionen stationiert. Der von den Flak-Scheinwerfern erzeugte Lichtstrahl reichte je nach Wetterlage bis zu zwölf Kilometer hoch. Im Zweiten Weltkrieg versuchte man, den an der Spitze der feindlichen Bombergeschwader fliegenden „Scout” („Pfadfinder”) zu blenden und ihm damit die Orientierung zu nehmen. Mit dem Lichtstrahl der Scheinwerfer wurden außerdem im Verband fliegende feindliche Flugzeuge angeleuchtet, um der Flugabwehr ein gut sichtbares Ziel zu bieten.
Die Erinnerungen an die letzten Kriegstage sind immer noch mit heftigen Emotionen verbunden. Wenn die Sirenen heulten, flüchteten wir in den Keller. Dieser erschien uns zunächst einigermaßen bomben- und granatensicher.
Ich höre sie noch, unsere auf Gott vertrauende, tiefgläubige, schwergewichtige Tante Viktoria (die Frau von Onkel Josef, dem Bruder des Großvaters, evakuiert aus Oberhausen): „Maria breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus; lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn..…”
Von Tag zu Tag wurde die Gefahr größer. In den Kellern war Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Die „Dorfältesten”, die nicht zum Kriegsdienst eingezogen waren, beschlossen, Schutzhütten zu bauen, um den bevorstehenden weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen im Dorf möglichst aus dem Wege zu gehen. Die Runsecke (Rossnacken) wurde als Standort ausgewählt. Innerhalb weniger Tage wurden hier ca 10 Hütten errichtet.
Mama hatte für jeden einen kleinen Rucksack vorbereitet mit dem Nötigsten. Ein wahnsinniger deutscher Offizier verkündete: „Das Dorf wird verteidigt bis zum letzten.” Unser Haus wurde zu einem Regimentsgefechtstand „ausgebaut”. Die verteidigenden Soldaten stürmen in die Häuser und rufen: „Binnen einer Stunde muss das ganze Dorf geräumt sein. Wer sich retten will, der fliehe. Jedes Haus wird verteidigt.”
Wir flüchten in die Runsecke. Dort gab es auch noch einen alten stillgelegten „Bergwerksstollen”, der teilweise als Bunker benutzt wurde. Vom Eingang des Stollens konnte man das Geschehen im Dorf beobachten.
Die Panzersperre unterhalb der Legge wird von amerikanischen Panzern überrollt. Durch Phosphorgranaten werden die ersten Häuser in Brand geschossen. Ich erinnere mich an „Mauermanns Tante Klara”: „Sagt, was ist mit unserem Haus? Brennt es schon?” „Nein, noch nicht!” Es sollte nicht lange dauern, bis wir sie erschüttern mussten: „Jetzt brennt Euer Haus auch!” Wiesen Haus, Schmelters Haus, Muses Haus, Stinans Haus, Dettenbergs Haus brennen lichterloh. Und unser Haus ist praktisch abbruchreif.
Aber es sollte noch schlimmer kommen. Wir sind in der Hütte von Hanröttches Onkel Adalbert (Heßmanns). Es ist schon dunkel. Die Runsecke wird unter Beschuss genommen. Eine Granate schlägt in einen Baum in unmittelbarer Nähe unserer Hütte ein. Ich sehe die Funken noch in meiner Erinnerung. Papa stöhnt auf. Ein Granatsplitter hat seinen Oberschenkel getroffen. Im Kugelhagel verlassen wir fluchtartig die Hütte. Papa bricht zusammen. Todesmutig zieht ihn jemand (?) aus der Gefahrenzone. Wir landen schließlich in Göbeln Hütte. Sie ist voll mit Menschen. Es herrscht Panik. Geschosse durchschlagen die Hütte über den Köpfen der Insassen. Es wird laut gebetet. Sollte das geholfen haben? Niemand wird getroffen.
Am nächsten Tag sind die Kämpfe vorbei. Wir ziehen mit weißer Fahne ins Dorf. Papa wird auf einem Wägelchen transportiert. Ich sehe zum ersten Mal „schwarze Menschen” (Soldaten). Das Dorf ist ein Trümmerfeld. Papa kommt zu amerikanischen Sanitätern, die sich bei Halbraucks einquartiert haben.
Wie soll es weitergehen. Unsere größte Sorge machen wir uns um Papa. Dann erfahren wir, dass er abtransportiert wurde. Niemand weiß wohin, angeblich in irgendein Lazarett in Hessen.
Wochenlang werden wir von Ungewissheit geplagt. Auch Jägers Papa ist als Verwundeter verschwunden. Jägers Anna, die Tochter, zieht los, um unsere Vermissten zu finden. Sie muss erfahren, dass ihr Vater verstorben ist. Wir erfahren schließlich über einen Fleckenberger (?), dass unser Papa sich in einem Lazarett in Marburg befindet. Es sollen dort chaotische Zustände herrschen.
Weit und breit gibt es nur ein Auto – in Altenhundem, Fahrschule Kasper Rath. Gegen einen Sack Zucker und einen Sack Reis gelingt es, dieses Auto zu mobilisieren. Papa wird am 10. Mai 1945, am Tag der Erstkommunion von Bruder Antonius, in desolatem Zustand zurücktransportiert. „Jetzt weiß ich, wie gut ein verschimmeltes, trockenes Stück Brot schmecken kann,” sind u.a. Worte, an die ich mich noch erinnern kann.
2. Erinnerungen an die Nachkriegsjahre
Das weitgehend zerstörte Elternhaus wird wieder hergerichtet; Papa erholt sich nur langsam von seiner schweren Verwundung. Die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln in den ersten Nachkriegsjahren ist erbärmlich. Minimale Portionen Brot gibt es nur auf Lebensmittelmarken, die unser Kostgänger, Forstmeister Rilling, vorschriftsmäßig auf genormte Briefbögen aufklebt.
Ich erinnere mich an die Schlangen von Menschen, die bei uns anstanden, um ein Brot zu erhaschen. Mama war eine wahre Wohltäterin; sie hat manches Brot auch ohne Lebensmittelmarken über die Ladentheke geschoben. Das war nur möglich, weil es Papa immer wieder gelang, Mehl aus „schwarzen Beständen” zu organisieren. Stundenlang war er oft zu Fuß unterwegs und hat um Mehl bzw. um Roggen gebettelt. Er kannte viele Bauern im „Haverland”, aber sein zuverlässigster Lieferant war Gödecke, ein befreundeter Müller in Nieder-Henneborn.
Eine kleine Geschichte, die verdeutlicht, wie brenzlig für viele die Situation war: Schlehdorns Walter war, wie auch immer, in den Besitz eines Tennisballes gekommen. Dieser Ball interessierte mich ungemein. Wir „kungelten”: Zwei Wochen lang jeden Morgen eine Doppelschnitte belegtes Brot, und der Ball sollte mir gehören. Also ich bat Mama fortan morgens um ein zusätzliches Butterbrot, das ich dann heimlich dem freudestrahlenden Walter überreichte. Es gelang mir nicht, den Handel geheim zu halten. Folge: Ich musste den Ball zurückgeben, während Walter trotzdem weiterhin sein morgendliches Butterbrot bekam.
Fahrräder waren absolute Mangelware. Die wenigen, welche noch existierten, waren verrostet, kaputt oder besaßen keine Bereifung mehr. Sie wurden, so gut es ging, in fahrbereiten Zustand versetzt. Ich sehe ihn noch, den stolzen Ferdinand (Flurschütz), wie er über die Jenseite radelte mit seinem verrosteten Drahtesel. Die Felgen waren überspannt mit Vollgummireifen. Wie andere auch, habe ich auf einem alten Herrenfahrrad das Radfahren gelernt. Ich musste unter der „Stange” fahren, weil ich ja noch zu klein war. Ich radelte von rechts, um nicht in unangenehmen Kontakt mit dem Kettenrad zu kommen.
Noch heute steige ich immer von rechts auf ein Fahrrad, und das erinnert mich immer noch an jene längst vergangenen Zeiten.
Im Jahre 1948 kam bekanntlich die Währungsreform. Unmittelbar danach gab es auch plötzlich neue Fahrräder. Ich sehe sie noch bei Zimmermanns Onkel Emil im Laden stehen. Auf mein Drängen und das von Bruder Antonius kaufte Papa schließlich ein neues Damenfahrrad. Nach kurzem Einüben startete ich, mit Schwester Marlies auf dem Gepäckträger, eine Fahrt „um die Schmiede” – im Uhrzeigersinn. Die Kurve bei Padts schafften wir nicht. Unsere Querneigung war nicht ausreichend!
Mit vollem Tempo sausten wir in den Gartenzaun. Es gab einige Schrammen, aber das Schlimmste war, das neue Radl war kaputt, die Vorderradgabel total verbogen.
Amerikanische Hilfe aus dem Marshallplan kam auch in Saalhausen an. Ich erinnere mich noch an das goldgelbe Maisbrot, das wunderbar aussah, aber weniger gut schmeckte. Bonbons „kochten” wir aus Zucker plus Butter. Mein um drei Jahre älterer Bruder Antonius, der die Vorkriegszeit, besser gesagt die ersten Kriegsjahre, noch bewusst erlebt hatte, pflegte dann zu berichten, dass es früher „richtige Bonbons” gegeben habe und dass wir solche sogar im Laden verkauft hätten.
Untereschbach, wo Onkel Franz (Zwillingsbruder von Papa), Tante Johanna (Schwester von Mama) auf ihrem kleinen Kotten mit sechs Kindern in der Nachkriegszeit ein sehr bescheidenes Dasein fristeten, ist eigentlich ein eigenes Kapitel wert. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln war es eine Tagesreise, um von Saalhausen nach Untereschbach zu kommen. Das letzte Teilstück von Overath über den Berg (Heiligenhaus) mussten wir manchmal zu Fuß zurücklegen. Einmal gelang es uns auch, von Untereschbach weiter zu reisen nach Köln. Unvorstellbar, Köln ein Trümmerhaufen - die Hohenzollernbrücke halb im Rhein liegend. – Auf unserem Balken gab es eine alte Holztruhe; darin befanden sich u.a. auch ein paar farbige Postkarten. Bruder Antonius zeigte mir eine Postkarte von Köln mit Dom, Hauptbahnhof und Hohen-zollernbrücke. „So schön sah Köln vor dem Krieg aus!” Ich konnte es nicht fassen.
Die religiöse Erziehung war aus heutiger Sicht keineswegs unbeschwert. Die Gewissenserforschung zusammen mit Mama vor der ersten Beichte und ersten hl. Kommunion fand ich bedrückend.
In den ersten Jahren danach „mussten” wir jede Woche zur Beichte gehen. Ich war sehr ängstlich und nahm alles sehr genau. Vor allem das Gebot der Keuschheit spielte eine große Rolle.
Ich pflege heute zu sagen: „Wir durften praktisch beim Pinkeln nicht hingucken !” Der Beichtspiegel wurde immer detalliert „durchgearbeitet”; in meiner Unsicherheit habe ich sogar manchmal gebeichtet: „Ich habe vielleicht unkeusche Gedanken gehabt!”
Und dann gab es ja auch noch die mir damals stark Angst machende Einteilung in schwere Sünden (Hölle) und lässliche Sünden (nur zeitlich begrenztes Fegefeuer).
Vor der hl. Kommunion durfte man keine Speisen und Getränke zu sich nehmen. Das führte auch oft zu Konfliktsituationen: „Habe ich nun beim Waschen etwas Wasser in den Mund bekommen und dieses etwa geschluckt? Kann ich nun zur hl. Kommunion gehen oder besser nicht ??”
Ich war auch Messdiener. Pastor Piel schenkte mir ein Aufklärungsbuch.
Papa sah dieses und befand, dass das noch zu früh für mich sei und ließ das Buch verschwinden. Das machte mich natürlich um so neugieriger. – Aufgeklärt wurde ich dann im Wesentlichen durch Bruder Antonius, der mir die „Dinge” dann auf seine Art erklärte.
Als Messdiener machten wir mit Lehrer Krüsemann eine Radtour nach Altastenberg, wo wir in jenen zusammengeknöpften 5-Eck-Zelten aus militärischen Beständen zelteten.
Von Altastenberg ging es später über den Albrechtsplatz hinunter nach Berleburg. Ein Angstzustand ist mir hier in Erinnerung. In voller kurvenreicher Bergabfahrt sprang plötzlich die Fahrradkette ab. Ich hatte keine Bremsmöglichkeit mehr. Eine Vorderradbremse gab es nicht.
Halbwegs in Panik presste ich, so fest es ging, meine Schuhe gegen die Bereifung des Hinterrades. Es gelang mir schließlich nach langer qualvoller Fahrstrecke, das Radel zum Stehen zu bringen.

Abb. 5: Volksschulklasse Saalhausen mit der Lehrerin Katharina Döbbener
- 1. Reihe von li.: Hildegard Stülper, Hildegard Lammers (+), Elfriede Klünker, Mechtild Schweinsberg, Nanni Hamers (Postes), Waltraud Grewe (+), Maria Wagner
- 2. Reihe von li.: Marita Metten, Sieglinde Kiesling, Magda Schöttler, Luzie Hufnagel (+), Waltraud Kleinsorge, Marianne Schöttler, Ute Baller, Rita Voß (+)
- 3. Reihe von li.: Christian Deitmer, Antonius Schröder (+), Katharina Döbbener (+), Franz-Josef Heimes, Willi Decker
- 4. Reihe von li.: Norbert Heßmann (+), Reinhold Döbbener, Josef Rauterkus (+), Karl-Heinz Luther (+), Uwe Baller, Peter Kuhlmann, Walter Trilling, Horst Volkmann, Herbert Jörg (+) Es fehlen: Alfons Mennekes (+), Siegfried Starcke (+)
Die ersten vier Schuljahre wurden wir betreut von der allseits beliebten Lehrerin „Döbbeners Kathrin”. Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Jahrgängen wir in einer Klasse vereint waren.
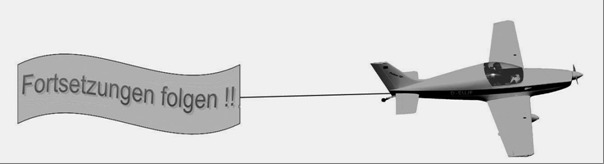
Zurück
Inhalt
Vor
|